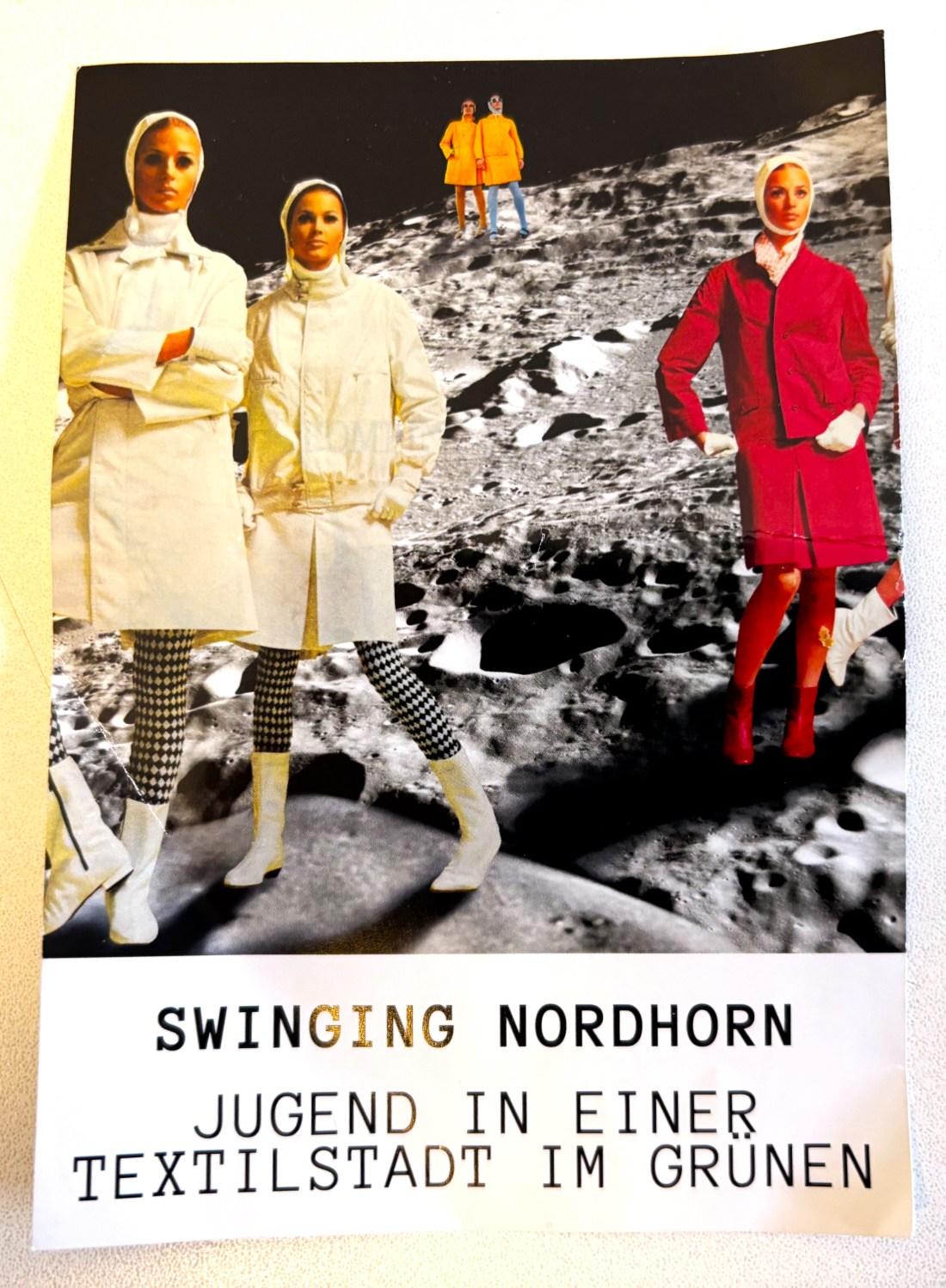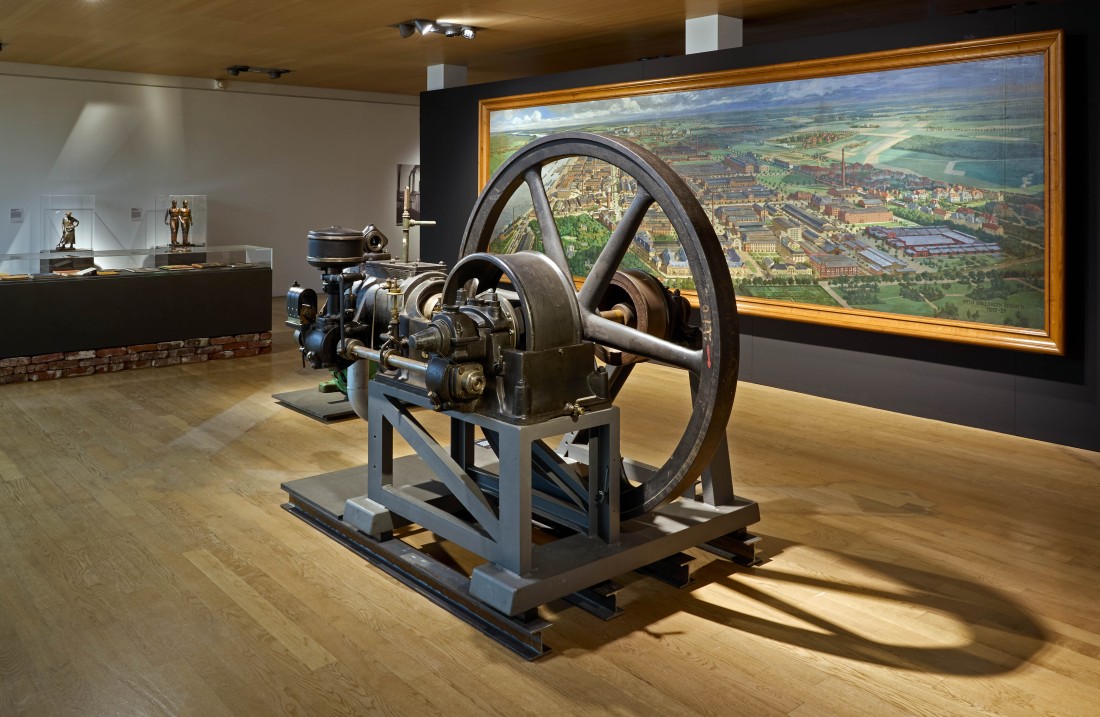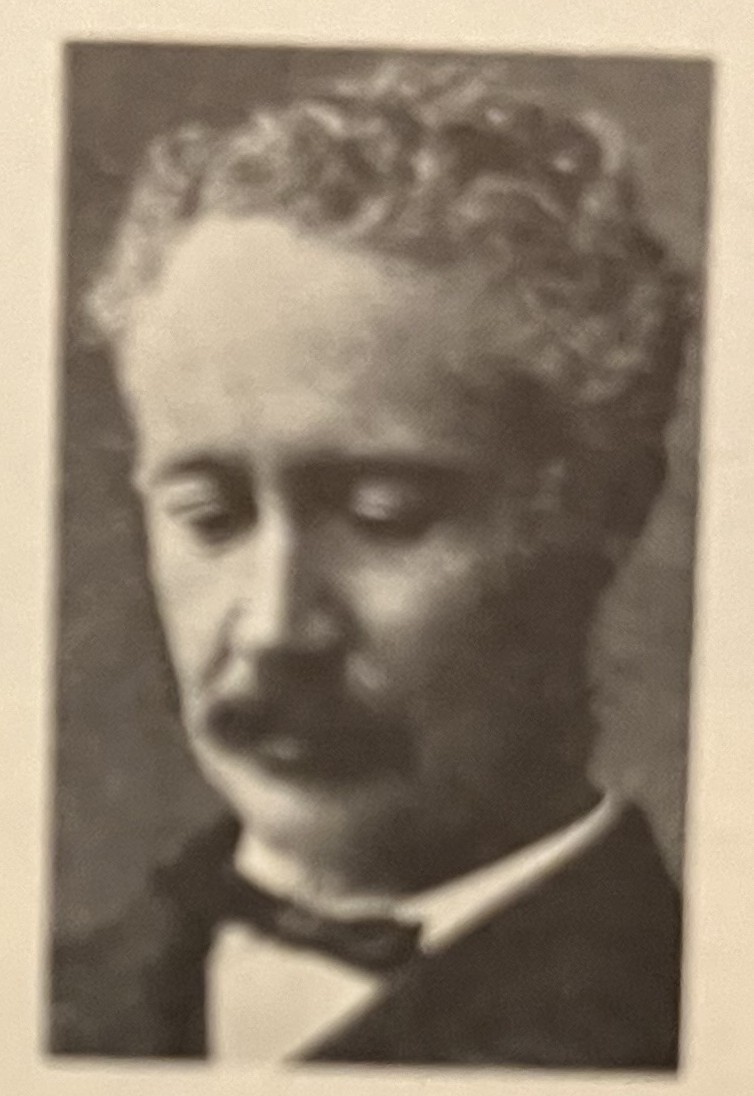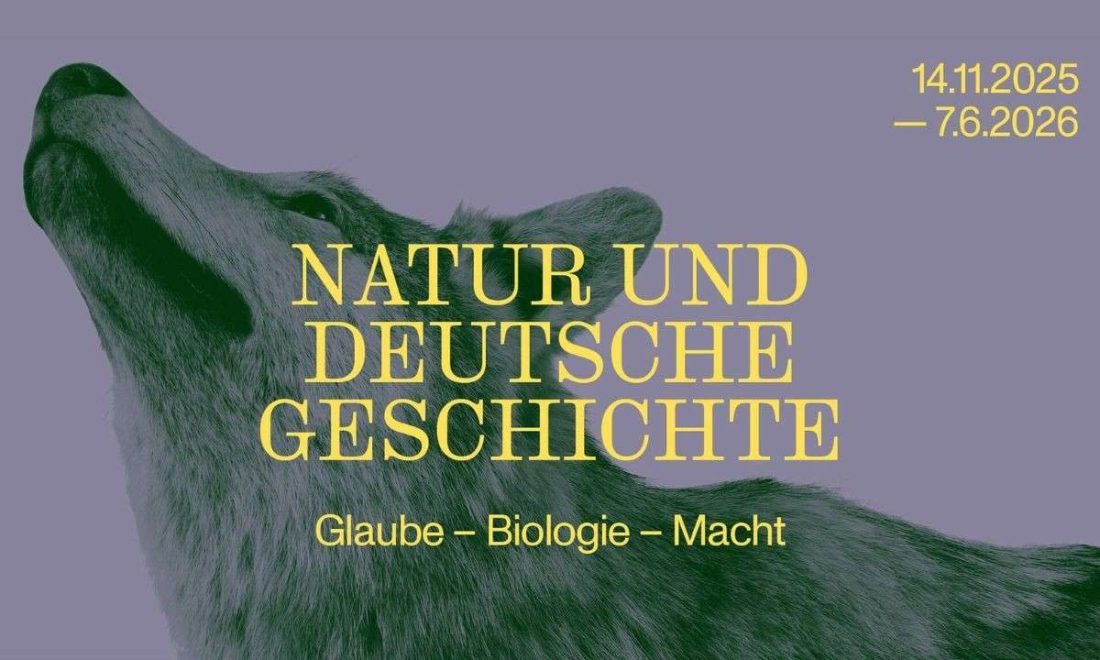Fachwerk, Altstadt und französisches Lebensgefühl – von Thomas Gatzemeier
Hier verlangsamt sich der Schritt fast von selbst. Die Petite Venise ist kein Ort, den man durchquert, sondern einer, an dem man hängen bleibt. Das Wasser liegt ruhig zwischen den Häusern, als hätte es sich an sie gewöhnt. Fachwerk, Putz, Dächer – alles spiegelt sich leicht verzerrt, nichts drängt nach vorne.
Der Flaneur nimmt wahr, wie nah hier gebaut wurde. Die Häuser stehen nicht dekorativ am Ufer, sie stehen am Wasser, weil es früher so sein musste. Die Lauch – der Fluss – war Arbeitsraum, Transportweg, Grenze und Verbindung zugleich. Dass heute Restaurant-Tische dort stehen, wo einst Boote anlegten, ist keine Verklärung, sondern eine Verschiebung der Nutzung.
Die Schwäne treiben durch das Bild wie ein ruhiger Kommentar. Sie gehören längst dazu, so wie das leise Stimmengewirr von den Tischen. Wer einen Tagesausflug nach Colmar macht, merkt hier, dass das französische Lebensgefühl weniger mit Sehenswürdigkeiten zu tun hat als mit dem selbstverständlichen Nebeneinander von Alltag und Geschichte. Man sitzt, man schaut, man bleibt einen Moment länger als geplant. Nur. Es sitzen eher Touristen als Franzosen hier. Zumindest am Tage.
Colmar hat diese Fassaden, die man nicht „besichtigt“, sondern irgendwann bemerkt. Man läuft unter ihnen hindurch wie unter einem Dach aus Geschichte. Fachwerk, helle Felder, Fensterläden, die offenstehen, als würde gleich jemand hinausschauen. Und dann: die irritierenden Figuren. Sie hängen da nicht wie etwas, das immer schon da gewesen wäre. Eher wie eine Setzung der Gegenwart. Skelettartig, mit Flügeln, deutlich als Requisit zu erkennen. Ein Eingriff, der das historische Haus nicht erklärt, sondern kurz aus dem Gleichgewicht bringt. Der Flaneur mag solche Stellen. Nicht, weil sie „schön“ sind, sondern weil sie zeigen, dass eine Altstadt nicht nur Vergangenheit ist. Colmar ist eine Bühne und mittlerweile voll auf Tourismus ausgerichtet. Und manchmal reicht ein einziges Stück Dekoration, um diese Bühne sichtbar zu machen.
Das gehört eigentlich nicht zu dem französischen Lebensgefühl, das man bei einem Tagesausflug nach Colmar sucht. Denn die Tradition tritt hier als Kulisse in Erscheinung und wird nicht als Alltag empfunden. Alte Häuser tragen neue Zeichen und werden zum Spektakel. Manchmal dezent, manchmal mit Absicht zu laut. Und während man noch überlegt, ob das Spiel ernst gemeint ist, hat man schon wieder ein paar Schritte gemacht. Colmar lässt einen nicht festhalten. Es lässt einen weitergehen. Oder man wird von den Massen weiter geschoben. Und dies alles wegen ein oder zwei Filmen die in Asien berühmt waren.
Wer bei seinem Tagesausflug durch Colmar läuft, stößt früher oder später auf diese kleinen, unscheinbaren Institutionen: diese Tabac-Presse Läden. Läden, die in Frankreich jahrzehntelang mehr war als Verkaufsstelle für Zigaretten. Man kaufte dort Zeitung und Briefmarken, gab eventuell ein Paket ab, füllte ein Lottoschein aus, wechselte ein paar Worte – und ging mit dem Gefühl hinaus, dass der Alltag hier noch eine Theke hat.
Das Schild in der Gasse ist fast schon ein kleines Zeitdokument. „Presse“ steht meist noch ganz oben, aber darunter sieht man, wie sich das Geschäft verschiebt: „Cigares“ und inzwischen „Vape“. Der Tabakkonsum geht zurück, die Regeln werden strenger, und die Läden reagieren pragmatisch. Wo früher vor allem Zigarettenstangen über den Tresen gingen, kommen heute Lotterie (FDJ), E-Zigaretten, Zubehör, manchmal auch Paketservices und kleine Convenience-Artikel dazu. Nicht als Lifestyle, eher als Überlebensform.
Für viele Deutsche aus dem Grenzgebiet war Frankreich lange ein Ziel mit sehr konkretem Grund: Zigaretten. Nicht nur wegen der Preise, sondern auch wegen des „anderen Geschmacks“ und dieses schwer greifbaren französischen Lebensgefühls, das man sich gleich mitkaufte. Namen wie Gauloises oder Gitanes hatten etwas von Film und Caféhaus, während internationale Marken wie Marlboro, Camel oder Lucky Strike eher das Vertraute bedienten und heute schon allein wegen Trump verachtet sind. Der Einkauf war für manche ein Ritual: rüberfahren, kurz durch eine Altstadt gehen, die Luft anders finden, und dann mit einem Päckchen Alltag nach Hause zurückkehren. Heute wirkt das wie eine Erinnerung aus einer Übergangszeit. Und genau deshalb passt so ein Schild so gut in einen Tagesausflug nach Colmar: Es zeigt nicht nur Fachwerk und hübsche Fensterläden, sondern auch, wie sich eine Stadt im Kleinen verändert. Nicht im Museum, sondern an einer ganz normalen Hauswand, in einer engen Gasse, zwischen Tradition und Anpassung.
Der Schwendi-Brunnen auf der Place de l’Ancienne Douane stammt ursprünglich aus dem Jahr 1898. Entworfen wurde er von Auguste Bartholdi, der mit der Figur des Lazare de Schwendi eine historische Persönlichkeit der Stadt ins Zentrum stellte. Immerhin hat Bartholdi die Freiheitstatue von New York entwurfen. Im Jahr 1940 verschwand der Brunnen jedoch aus dem Stadtbild. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Anlage zerstört; das Elsass war zu dieser Zeit von Deutschland besetzt. Über die konkreten Umstände des Abbruchs – ob kriegsbedingt, aus materialtechnischen Gründen oder durch administrative Entscheidungen – geben die Quellen keine eindeutige Auskunft.
Belegt ist lediglich, dass der Brunnen seine ursprüngliche Gestalt verlor und nach dem Krieg in veränderter Form wieder aufgebaut wurde. Heute steht er erneut auf dem Platz, nicht als unverändertes Denkmal, sondern als sichtbares Zeichen einer unterbrochenen Geschichte. Man darf jedoch annehmen, dass die Nazis den Bildhauer hassten, weil er die Freiheitsstatue entworfen hatte. An solchen Ecken bleibt man stehen, ohne es zu planen.
Das Eckhaus schiebt sich in den Blick, als wolle es sagen: Hier beginnt etwas anderes. Die Straße öffnet sich kurz, dann zieht sie sich wieder zusammen. Fachwerk, Farbe, Fensterläden – alles bekannt, und doch jedes Mal neu zusammengesetzt. Der Flaneur nimmt wahr, dass diese Häuser nicht nur Kulisse sind. Unten wird gegessen, getrunken, gesprochen. Oben gewohnt. Die klare Ordnung der Fassaden erzählt von einer Zeit, in der Bauweise auch Haltung war. Gleichzeitig ist alles gegenwärtig: Markisen, Tafeln, Stimmen. Die Altstadt von Colmar lebt davon, dass sie sich benutzen lässt. Ein Tagesausflug nach Colmar führt zwangsläufig an solchen Punkten vorbei. Nicht als Ziel, sondern als Übergang. Man steht kurz, schaut nach links, nach rechts – und geht weiter, ohne genau zu wissen, warum dieser Ort im Gedächtnis bleibt. Gerade deshalb bleibt er. Hier geht man nicht einfach vorbei.
Der Weg am Wasser zwingt zur Langsamkeit. Der Langsamkeit eines Flaneurs. Links die Häuser, dicht an dicht, jedes anders gefasst, und doch Teil derselben Reihe. Rechts der Kanal, ruhig, fast gleichgültig gegenüber dem Treiben.
Der Flaneur beobachtet, wie sich dieser Ort benutzt anfühlt. Menschen bleiben stehen, lehnen am Geländer, schauen ins Wasser oder auf die Fassaden gegenüber. Das Viertel war einmal Arbeitsraum; heute ist es ein Ort des Gehens und Verweilens. Beides schließt sich nicht aus.
Ein Tagesausflug nach Colmar findet an solchen Stellen sein Maß. Man sieht nicht nur Fachwerk und Altstadt, man spürt, wie nah hier Geschichte und Gegenwart beieinanderliegen. Der Weg führt weiter, aber er lässt einen nicht eilig werden. Hier schaut der Flaneur nach oben. Nicht, weil etwas spektakulär wäre, sondern weil sich das Leben an der Fassade zeigt. Balkone, Fensterläden, Blumenkästen – nichts davon ist Bühne, alles ist Gebrauch. Die Häuser wirken bewohnt, nicht ausgestellt. Die Balkone erzählen von einer anderen Art, Raum zu denken. Nicht als abgeschlossene Einheit, sondern als etwas, das sich nach außen fortsetzt. Man stellt etwas ab, man lehnt sich hinaus, man lässt Dinge hängen. Das Fachwerk hält das zusammen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.
In der Petite Venise sind solche Ansichten oft nur ein paar Schritte vom Wasser entfernt. Ein Tagesausflug nach Colmar besteht dann nicht aus einem Ziel, sondern aus Blicken wie diesem. Man geht weiter, aber der Gedanke bleibt kurz hängen – an einem Balkon, an einem Fenster, an der Selbstverständlichkeit, mit der hier gewohnt wird. Oder doch alles Unterkünfte von Airbnb? Man wird es nicht erfahren. Aber wo wohnen all die Asiaten, die hier herumwuseln?
Manchmal reicht es, sitzen zu bleiben. Der Flaneur hebt den Blick, nicht aus Neugier, sondern aus Ruhe. Über dem Tisch spannen sich Markisen, Schirme, Streben. Nichts davon ist geplant für den Blick nach oben, und doch ergibt es eine Ordnung. Eine zufällige Architektur entstanden aus dem Wunsch nach „Beschirmung“.
Hier sitzt man geschützt, leicht abgeschirmt vom Himmel, und hört das, was eine Altstadt eben mit sich bringt: Stimmen, Geschirr, Schritte. Auf dem Tisch ein Flammkuchen, daneben ein Glas elsässischer Riesling. Keine Inszenierung, sondern Alltag. Die Markisen erzählen davon, wie sehr diese Stadt darauf eingestellt ist, draußen zu sitzen – auch dann, wenn der Raum eigentlich fehlt.
Ein Tagesausflug nach Colmar besteht nicht nur aus Wegen und Plätzen. Er besteht auch aus diesen Pausen. Aus Blicken, die nichts festhalten wollen. Man isst, man trinkt, man schaut nach oben – und merkt erst später, dass genau das geblieben ist. Das sind die Momente, an die man im harschen deutschen Alltag sehnsüchtig denkt.
In der Adventszeit zeigt sich Colmar von einer besonders dichten Seite. Schaufenster werden zu Bühnen, dekoriert bis in den letzten Winkel, als müsse jedes Detail mit dem Strom der Besucher konkurrieren. Wer hier stehen bleibt, merkt schnell, dass es nicht mehr um Stille geht, sondern um Sichtbarkeit. Wie sich die Stadt in diesen Wochen verändert, was der Weihnachtszauber mit dem Stadtraum macht – und warum der Andrang selbst zum Thema wird –, darüber geht es in meinem Text „Colmar im Weihnachtswahn“. Ein Blick hinter die Kulissen einer Stadt, die im Winter besonders viele Blicke auf sich zieht.
Der figürliche Fassadenschmuck bündelt, was als elsässisch gelesen werden soll: Störche, Tracht, ländliche Tiere, ein angedeutetes Fachwerkhaus. Alles ist klar erkennbar, alles auf einmal und hübsch beieinander. Solche Darstellungen gehören zur Volkskunst des Elsass und sollen des Touristen Herz erfreuen. Sie sind keine überlieferten Hauszeichen, sondern bewusst gesetzte Bilder, entstanden im Spannungsfeld von regionaler Identität, die schon längst verschwunden ist und touristischer Erwartung der erfüllt werden muss. Der Storch steht dabei als zentrales Symbol für Heimat und Beständigkeit, die Trachtfiguren verweisen weniger auf gelebte Geschichte als auf deren Bildtradition.
Für den Flaneur ist dieses Element kein Schmuck im architektonischen Sinn. Es ist eine Erzählung an der Wand. Colmar zeigt sich hier nicht als gewachsene Stadt, sondern als Stadt, die die Erwartungen ihrer Besucher kennt – und diese sichtbar befriedigt. Da kommt dann schon mal der Chinese vorbei und denkt: huch haben die es heimelig.
Die Rue des Marchands ist eine jener Straßen, in denen Colmar sein Tempo zeigt – das Tempo der Touristen. Fachwerk, Fensterläden, Ausleger und Markisen bilden eine dichte Abfolge, die kaum Pausen lässt. Hier geht man nicht verloren, hier wird man weitergeschoben – von Geschäft zu Geschäft, von Blick zu Blick. Für den Flaneur ist diese Straße weniger Ort des Verweilens als des Beobachtens. Man liest an den Fassaden, wie sich die Altstadt organisiert: oben gewohnt, unten verkauft, dazwischen Geschichte und Gegenwart eng verzahnt. Ein Tagesausflug nach Colmar führt fast zwangsläufig hierher, weil sich an solchen Straßen das französische Lebensgefühl der Stadt besonders deutlich zeigt – geschäftig, dicht, und doch eingebettet in historische Formen. Und gerade diese Straße war für mich reizvoll, da die Fassaden Patina zeigten und nicht als Schauflächen für die Besucher herausgeputzt waren. An solchen Plätzen sammelt sich die Stadt. Fachwerk, Geschäfte, Wegweiser und Menschen kreuzen sich auf engem Raum. Nichts ist monumental, alles wirkt gewachsen. Der Flaneur bleibt kurz stehen, nicht weil etwas hervorsticht, sondern weil sich hier vieles überlagert.
Ein Tagesausflug nach Colmar führt unweigerlich durch solche Übergangsräume. Zwischen Museum, Altstadt und Einkaufsstraße zeigt sich das französische Lebensgefühl der Stadt in Bewegung: ein kurzer Blick, ein Richtungswechsel, ein weiterer Schritt durch die Geschichte, die hier selbstverständlich Teil des Alltags ist.
Auch wenn es einem recht heimelig beim Anblick der alten Fachwerkhäuser wird, darf man nicht vergessen, wie mühselig das Leben in der Zeit war, als diese Häuser „Neubauten“ waren. Aber der Flaneur an sich und ich im Besonderen bin ein positiv denkender Mensch und vertiefe mich ungern in Dinge, die meine Fröhlichkeit negativ beeinflussen könnten. Es kommt schon noch härter, wenn ich von den Grünewaldaltartafeln stehe. Wenn Sie möchten, so lesen Sie „Otto Dix trifft Grünewald in Colmar“.
Kulinarische Zwischenstationen beim Tagesbesuch in Colmar
Irgendwann setzt man sich. Nicht aus Hunger allein, sondern weil die Stadt es nahelegt. Bistro, Taverne, ein Tisch am Rand – das gehört zu einem Tagesausflug nach Colmar wie das Fachwerk zur Fassade. Die elsässische Küche ist dabei klar umrissen und unterscheidet sich deutlich von dem, was man sonst in Frankreich erwartet.
Der Flammkuchen, hier selbstverständlich Tarte flambée genannt, ist kein Gericht für den großen Auftritt. Dünner Teig, Sauerrahm, Zwiebeln, Speck – mehr braucht es nicht. Er kommt nicht als Hauptgang, sondern als Begleiter, oft in mehreren Varianten, geteilt am Tisch. Weniger Mahlzeit als Rhythmusgeber. Deutlicher wird die Eigenständigkeit bei der Choucroute garnie. Sauerkraut, Würste, gepökeltes Fleisch – kräftig, sättigend, ohne jede Leichtigkeit und sehr ans Deutsche erinnernd. Diese Küche schaut nicht nach Paris, sondern über den Rhein nach Osten oder auch nach Bayern. Auch der Baeckeoffe, ein langsam gegarter Ofeneintopf aus Fleisch, Kartoffeln und Zwiebeln, gehört zu dieser Tradition des Geduldigen und Bodenständigen. Fast unscheinbar, aber charakteristisch sind die Fleischschnacka: gefüllte Nudelscheiben, in der Pfanne gebraten. Ein Restegericht ursprünglich, heute fester Bestandteil der regionalen Küche. Nichts davon will modern sein, alles will bleiben. Und das macht diese Küche so sympatisch.
Dazu werden elsässische Weine getrunken – Riesling, Pinot Blanc, Gewürztraminer. Trocken, aromatisch, ohne Umwege. Sie begleiten das Essen, sie kommentieren es nicht. Auch hier zeigt sich der Unterschied zu anderen Regionen Frankreichs: weniger Inszenierung, mehr Selbstverständlichkeit.
Wer in Colmar isst, merkt schnell, dass Essen hier kein Ereignis ist, sondern Teil des Gehens. Man setzt sich, man isst, man steht wieder auf – und nimmt etwas mit, das nicht nur satt macht. Wer Colmar besucht, sitzt früher oder später draußen. Nicht, weil das Wetter perfekt wäre, sondern weil es dazugehört. Das Draußensitzen ist in Frankreich keine saisonale Ausnahme, sondern Teil der Stadtkultur. Tische stehen nicht am Rand, sie stehen im Raum. Man schaut, man wird gesehen, man bleibt.
Gerade in der Altstadt von Colmar wird diese Haltung sichtbar. Zwischen Fachwerkhäusern, Winstuben und kleinen Restaurants wird der Platz zum Wohnzimmer. Essen und Trinken sind dabei fast nebensächlich. Wichtiger ist das Verweilen, das langsame Gespräch, das Gefühl, Teil des Stadtbildes zu sein. Dass wir diese Form der Außengastronomie inzwischen auch in Deutschland übernommen haben, ist ein Glück. In Colmar aber merkt man, woher sie kommt: aus einer Selbstverständlichkeit heraus, die Öffentlichkeit nicht zu meiden, sondern zu nutzen. Draußensitzen ist hier keine Mode – es ist eine Haltung.
Fassadenschmuck in Colmar – Ein Alleinstellungsmerkmal?
Beim Gang durch die Altstadt fällt auf, dass viele Fassaden mehr zeigen als bloß Architektur. Neben dem historischen Fachwerk treten Objekte, Figuren und ganze Arrangements, die bewusst in das Stadtbild eingreifen. Gießkannen, Werkzeuge oder Tiere ersetzen den klassischen Blumenschmuck und machen die Häuser selbst zu Schauflächen. Dieser Fassadenschmuck ist keine überlieferte Bauform, sondern eine zeitgenössische Praxis. Es handelt sich häufig um saisonale oder geschäftsbezogene Dekorationen, die das „Märchenbild“ der Altstadt gezielt verstärken. Besonders zur Weihnachtszeit wird diese Inszenierung sichtbar, wenn Colmar den öffentlichen Raum bewusst bespielt und als eigenes Programm vermarktet.
So entsteht ein Spannungsfeld zwischen historischer Substanz und heutiger Erzählfreude. Die Häuser bleiben, was sie sind – Zeugnisse einer alten Stadt –, doch ihre Fassaden werden ergänzt, kommentiert, manchmal auch überzeichnet. Colmar zeigt sich hier nicht nur als bewahrte Altstadt, sondern als gestalteter Stadtraum, in dem Tradition und Inszenierung nebeneinander existieren aber auch vor dem globalen Tourismus eine große Verbeugung machen. Nicht jeder Einheimische klatscht da in die Hände. Ja manche ballen sie in der Tasche zur Faust. Aber man lebt hier sehr gut von mir und all den anderen welche die Stadt überfluten.
Zum Autor:
Am dunkelsten Tag des Jahres 1954 im sächsischen Döbeln geboren, wurde Thomas Gatzemeier ungefragt von einem katholischen Pfarrer getauft. Als Kind buk er heimlich einen Kuchen, der als Brot gut ankam. Dieses scheinbare Missgeschick inspirierte ihn dazu, eine Ausbildung als Schrift- und Plakatmaler zu absolvieren, um Pinsel und Stift zu beherrschen. Er arbeitete anschließend auch als Steinmetzgehilfe und Grabsteindesigner. Nach dieser Grundausbildung studierte er Malerei und Grafik an der renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wo Arno Rink und Volker Stelzmann zu seinen Lehrern zählten. 1980 beendete er sein Studium und ist seitdem als freier Künstler, Autor, Kunsthändler, Blogger und Freizeitkoch tätig. Konflikte mit den Machthabern der SBZ (Sozialistische Besatzungszone, später DDR) und ein mehrjähriges Ausstellungsverbot bewegten ihn 1986 dazu, die SBZ zu verlassen.
Danach lebte er vorwiegend in Karlsruhe, verbrachte aber auch längere Zeit in Zürich und nahe Worpswede. Von 2006 bis 2015 hatte er ein weiteres Atelier in Leipzig. Nach 34 Jahren Hauptwohnsitz in Karlsruhe verlegte der Wanderer zwischen den Welten im Februar 2020 seinen Wohnsitz endgültig nach Leipzig.
Nähere Informationen: Thomas Gatzemeier, Gottschallstraße 24, 04157 Leipzig, Telefon: 0172 610 25 35, E-Mail: info@thomas-gatzemeier.de