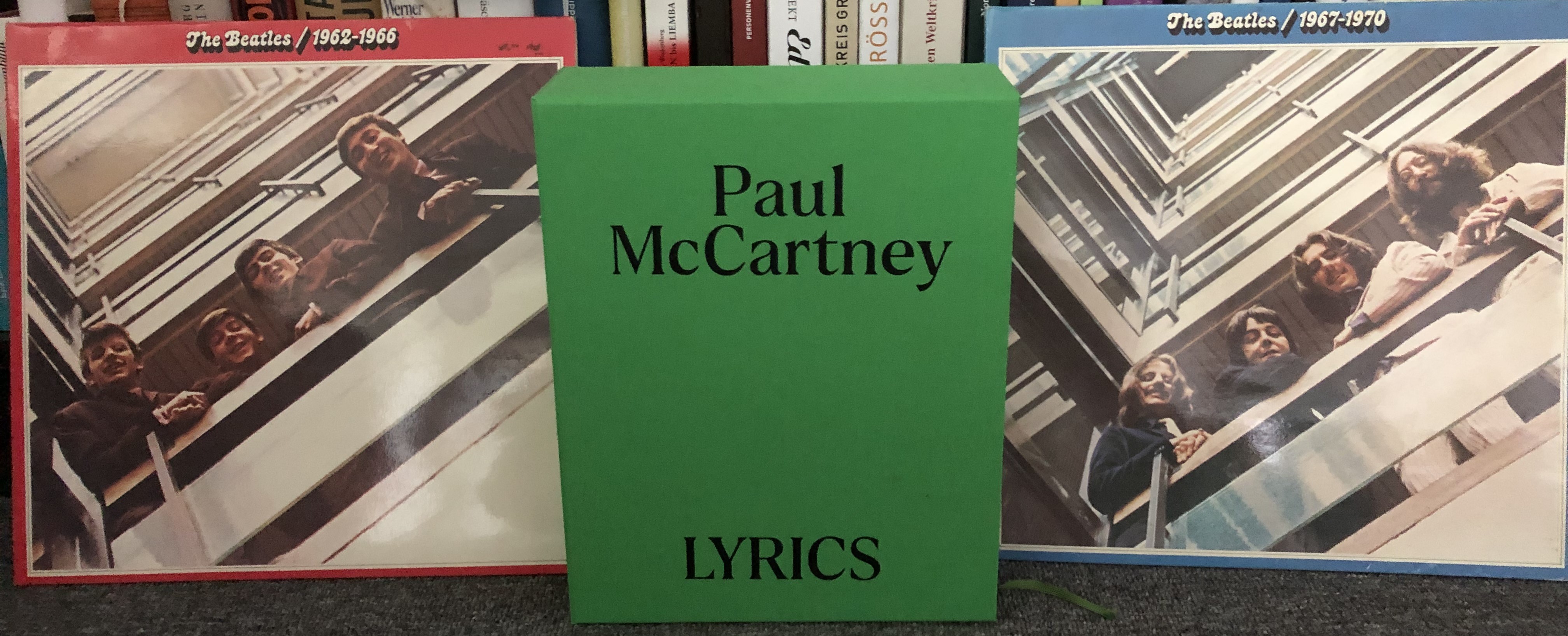„Diesen hör ich, sind wir los geworden Und er wird es nicht mehr weiter treiben Er hat aufgehört, uns zu ermorden. Leider gibt es sonst nichts zu beschreiben. Diesen nämlich sind wir los geworden Aber viele weiß ich, die uns bleiben.“ – dieses Zitat von Bertolt Brecht aus dessen Text „Auf den Tod eines Verbrechers“ stellt Alfred Andersch seiner Erzählung „Der Vater eines Mördeers“ voran. Und spätestens auf Seite 47 dieses posthum erschienenen Werkes wird mit der Nennung eines Namens klar, worauf Brecht mit seinen bewusst kalt klingenden, von jeglichem Mitleid freien Zeilen ansprach: Himmler. Wer in diesem Zusammenhang an Heinrich Himmler, SS-Chef während der Herrschaft des Nationalsozialismus und einen der schlimmsten Verbrecher der Menschheitsgeschichte, denkt, ist schon auf der richtigen Spur, aber nicht ganz.
Brechts Worte betrafen allerdings nicht nur eine Person, sondern alle vom Ungeist des Nationalsozialismus beherrschten Menschen und deren menschenverachtende, raubmörderische Ideologie.
Der Autor (*1914 +1980), den vor allem viele Abiturienten älteren Jahrgangs wegen seines Romans „Sansibar oder der letzte Grund“ kennen, der Ende der 1970-er, Anfang der 1980-er Jahre und auch in späteren Zeiten oft noch verpflichtende Schullektüre war, beschäftigte sich in seinen vielfach autobiografisch geprägten Werken immer wieder mit dem Nationalsozialismus, dessen Ursachen, Voraussetzungen und Folgen. Unter anderem in seinem Roman „Winterspelt“, in dem er seine Desertation aus der deutschen Wehrmacht und das Überlaufen zur US-Armee im Zweiten Weltkrieg thematisiert.
In seiner ebenfalls autobiografisch geprägten Erzählung „Der Vater eines Mörders“ geht Andersch zurück in den Monat Mai des Jahres 1928. Aus der Sicht der Figur des Franz Kien, Schüler am Wittelsbacher Gymnasium in München, schildert er ein äußerst eindrückliches Erlebnis, das den immer noch herrschenden autoritären Geist der eigentlich vergangenen Ära Kaiser Wilhelms II. widerspiegelt, neun Jahre nach der durch die November-Revolution erzwungene Abdankung dieses seinem Amt nicht gewachsenen Monarchen.
Der neue Geist der 1919 mit der Weimarer Republik geschaffenen Demokratie hatte sich noch längst nicht in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens durchgesetzt. Das galt auch für die Schulen. Nationalismus und der blinde Glaube an überkommene Hierarchien bestimmten das Denken vieler Deutscher
Sehr deutlich wird das in der Erzählung von Alfred Andersch durch das Auftreten des Schuldirektors während einer Griechisch-Stunde. Was zunächst wie eine Inspektion des Unterrichts beginnt, entfaltet sich zu einem „Miniaturdrama auf engstem Raum und in kürzester Zeit“, wie der deutsche Journalist, Autor, Literatur- und Filmkritiker Wolfram Schütte schreibt.
Andersch schreibt von einem Erlebnis, dass sich unauslöschlich bei ihm eingebrannt hat.
Ohne Ankündigung tritt der „Rex“, wie er von Schüler Franz Kien – Alter ego von Alfred Anersch in mehreren seiner Werke – genannt wird, noch vor Unterrichtsbeginn in den Klassenraum der Untertertia ein. Auch Lehrer Kandlbinder ist nicht informiert. Mit der Zeit übernimmt der „Rex“ den Unterricht, kritisiert den Wissensstand der Schüler in verächtlichem Ton als nicht ausreichend und nimmt auch die dem Unterricht zugrunde liegende Grammatik aufs Korn, die er voll Hohn und Spott als nicht geeignet für die Altersklasse der Untertertia erklärt.
Die Degradierung des Lehrers ist in vollem Gange, doch richtig schlimm wird die Situation im Klassenraum mit dem Auftritt des von Kandlbinder aufgerufenen Schülers Konrad von Greiff, der eine Frage zur griechischen Grammatik beantworten soll. Er antwortet auf die Aufforderung seines Lehrers mit einem süffisant klingenden „Sehr gerne, Herr Doktor Kandlbinder“ und unterstreicht damit für alle deutlich die Ablehnung der Autorität Kandlbinders, und das auch noch in Gegenwart des Schuldirektors. Der „Rex“ bezeichnet die Antwort von Greiffs als unerlaubte Bereitwilligkeitserklärung, verweist auf die als Anrede für alle Lehrer gängige Titulierung Professor (nicht Herr Doktor) und verordnet als Strafe zunächst eine Stunde Arrest. Doch damit ist der Konflikt noch lange nicht beendet. Jetzt nimmt sich der Schuldirektor den Schüler weiter vor und kanzelt ihn vor der ganzen Klasse mit dem lateinischen Zitat „Quod licet Jovi, non licet bovi“ ab, was in deutscher Übersetzung „Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt“ heißt und sich in der Erzählung von Andersch darauf bezieht, dass der „Rex“ Lehrer Kandlbinder aufgrund seines hohen Ranges als Herr Doktor ansprechen kann, aber nicht der Schüler von Greiff. Und dann kommt eine Antwort, die vor allem wegen eines Namens einen großen Schrecken beim Leser auslöst: „Ich gehöre nicht zum Rindvieh“, stieß er (Konrad von Greiff) hervor. „Und Sie sind nicht Jupiter. Für mich nicht! Ich bin ein Freiherr von Greiff, und Sie sind nichts weiter als ein Herr Himmler.“
Jetzt ist der Name gefallen, der Name eines der schlimmsten Verbrecher in der Zeit der totalitären und mörderischen Nazi-Herrschaft, Chef der gefürchteten SS und verantwortlich für den millionenfachen Mord an den Juden; doch bei dem in der Erzählung angesprochenen Himmler handelt es sich nicht um den Nazi-Schergen, sondern um dessen Vater, der eher der katholischen, deutsch-nationalen Bayrischen Volkspartei zuzuordnen ist. Vater und Sohn stehen also in unterschiedlichen politischen Lagern und sind übrigens dadurch in Streit geraten, wie vom Vater Franz Kiens im Gespräch mit seinem Sohn zu erfahren ist.
Im „Nachwort für Leser“ belegt Alfred Andersch den autobiografischen Bezug seiner Erzählung: „Ich bin es doch gewesen, ich und niemand anderer, der von dem alten Himmler in Griechisch geprüft und infolge des blamablen Ergebnisses aus dem humanistischen Gymnasium eskamotiert (entfernt) worden ist.“ In der Figur des Franz Kien, die dem Erzähler nach eigenen Worten „eine gewisse Freiheit des Erzählens“ ermöglicht, wird Alfred Andersch zum weiteren Opfer des autoritären Himmler sen.
Die vom Rex gestellte Aufgabe, den Satz „Es ist verdienstvoll, Franz Kien zu loben“ als Beispiel für den Gebrauch des Infinitivs ins Griechische zu übersetzen, kann er nicht erfüllen und wird vor seinen Schulkameraden in unerbittlichster Weise vorgeführt.
Zwei Sätze Himmlers bringen das zum Ende der Examination Kiens deutlich zum Ausdruck: „Du wirst die Untertertia nicht erreichen“ und „Dabei könntest du, wenn du wolltest. Aber du willst nicht.“ Aber damit hört die Degradierung noch nicht auf. Auf die zunächst persönlich klingende Frage nach den beruflichen Ambitionen Kiens, der auf diese mit Schriftsteller antwortet und auf die nach seinem Lieblingsautor mit Karl May, kommt ihm nochmals die geballte Verachtung Himmlers sen. entgegen; und dieser wird dann auch noch in privaten Angelegenheiten Kiens indiskret, ebenso, wie er es bei Konrad von Greiff und dessen familiärer Biographie (Beleidigung des Standes der Freiherrn als Bauernschänder) getan hat. Er unterlässt es nicht, vor der ganzen Klasse auf die Armut der Familie Kien hinzuweisen, die nicht in der Lage sei, das Schulgeld zu bezahlen, dass man nur erlassen könne, wenn die Leistungen von Franz und seinem Bruder Karl, der ebenfalls das Gymnasium besucht, gut wären, was sie aber nicht seien.
Die Erzählung endet mit dem Verlassen des Klassenzimmers vor Unterrichtsende durch den „Rex“ und mit der von Franz Kien gleichgültig aufgenommenen Degradierung, der nach der Schule seinen freizeitlichen Aktivitäten wie gewohnt nachgeht. Fünf Jahre später erfolgt die Machtübernahme in Deutschland durch die Nationalsozialisten, aber das ist ein anderes Kapitel.
Vorhang zu und alle Fragen offen? Zur Figur des Schuldirektors Himmler gibt es im Nachwort von Andersch noch ein paar Informationen, die eine ungefähre Annäherung an diese Person ermöglichen. Der Autor rechnet ihn der Kaderschule des bairischen Ultramontanismus zu, einer politischen Haltung des Katholizismus, die sich insbesondere in deutschsprachigen Ländern auf Weisungen von der päpstlichen Kurie, also aus dem von dort aus gesehen „jenseits der Berge“ (lateinisch ultra montes – gemeint sind die Alpen) liegenden Vatikan stützte. Diese Haltung ging einher mit dem Antimodernismus, einer Strömung innerhalb der gesamten katholischen Kirche, die sich insbesondere in der zweiten Hälfte ds 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts gegen gesellschaftliche und politische Reformen zur Durchsetzung von Menschenrechten und Demokratie wandte, kurz gesagt gegen unser heutiges Verständnis einer demokratischen Gesellschaftsordnung, deren Vorprägung es schon in der Weimarer Republik gab.
Ob Himmler sen. sich mit seinem Sohn Heinrich, einem fanatischen Anhänger der Nazi-Ideologie, nach der Machtergreifung durch die NSDAP aussöhnte, bleibt offen. Nur eine Ehrensalve der SS nach dessen Tod über seinem Sarg ist überliefert. Was bleibt, ist die Tatsache, „daß der alte Himmler der Vater eines Mörders war.“ Wie Andersch weiter ausführt, ist die „Bezeichnung Mörder für Heinrich Himmler… milde; er ist nicht irgendein Kapitalverbrecher gewesen, sondern, so weit meine historischen Kenntnisse reichen, der größte Vernichter des menschlichen Lebens, den es je gegeben hat.“
Der Autor erhebt trotz dieses familiären Hintergrundes für seine Erzählung nicht den Anspruch, „die private, die persönliche Wahrheit dieses Menschen, des Rex, zu bestimmen“, und auch Kausalitäten zwischen der Persönlichkeit des alten Himmler und der Entwicklung seines Sohnes zu einem der größten Verbrecher der Nazi-Diktatur mag er ungern herstellen. Andersch erläutert seine Haltung zu diesen Fragen in aller Ausführlichkeit: „War es dem alten Himmler vorbestimmt, der Vater des jungen zu werden? Mußte aus einem solchen Vater mit Naturnotwendigkeit, d. h. nach sehr verständlichen psychologischen Regeln, nach den Gesetzes des Kampfes zwischen aufeinander folgenden Generationen und den paradoxen Folgen der Familien-Tradition, ein solcher Sohn hervorgehen? Waren beide, Vater und Sohn, die Produkte eines Milieus und einer politischen Lage, oder, gerade entgegengesetzt, die Opfer von Schicksal, welches bekanntlich unabwendbar ist – die bei uns Deutschen beliebteste aller Vorstellungen? Ich gestehe, daß ich auf solche Fragen keine Antwort weiß.“
Und als Autor nimmt Andersch für sich in Anspruch, kein Interesse am Schreiben einer Geschichte mit klaren Zuordnungen zu den darin handelnden Personen zu haben: „Ein Interesse… wird ausschließlich durch den Anblick offener Figuren ausgelöst, nicht von solchen, über die ich schon ganz genau Bescheid weiß, ehe ich anfange, zu schreiben.“
Trotzdem bleibt für Andersch eine Frage: „Angemerkt sei nur noch, wie des Nachdenkens würdig es doch ist, daß Heinrich Himmler, – und dafür liefert meine Erinnerung den Beweis -, nicht wie der Mensch, dessen Hypnose er (gemeint ist Adolf Hitler, dessen glühender Anhänger Heinrich Himmler war) erlag, im Lumpenproletariat aufgewachsen ist, sondern in einer Familie aus altem, hunmanistisch fein gebildetem Bürgertum. Schützt Humanismus denn vor gar nichts? Die Frage ist geeignet, einen in Verzweiflung zu stürzen.“
Was bleibt ist eine spannende und tiefsinnige, um viele wesentliche Fragen kreisende Erzählung aus der Zeit der von vielen Irrungen und Wirrungen geprägten Weimarer Republik, die unbedingt die Lektüre lohnt. Zitiert sei an dieser Stelle der bekannte Literaturkritiker Joachim Kaiser, einer der führenden Vertreter seiner Zunft über mehrere Jahrzehnte, aus einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung: „Ein meisterhafter Text, ein konzentriertes, dramatisches, spannendes Prosa-Stück.“